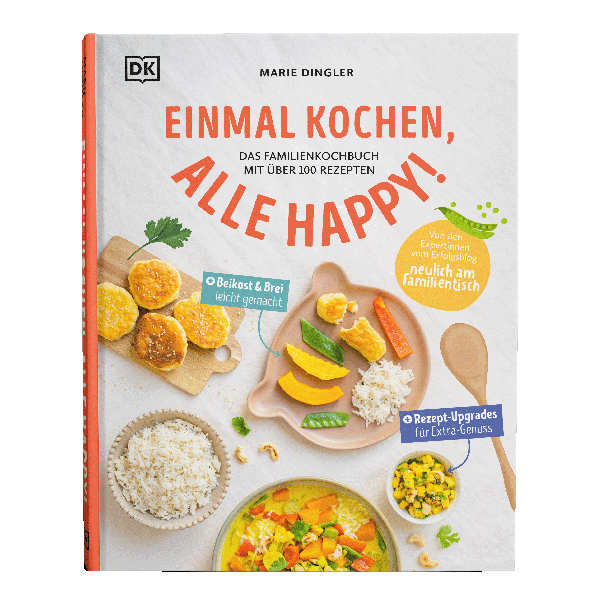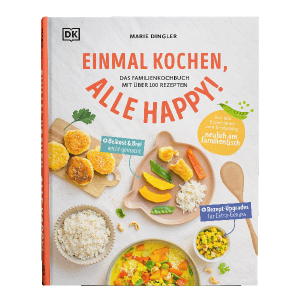No products in the cart.
Ob stummes Abendessen am Esstisch oder gemeinsames TV-Dinner auf der Couch: Über Medien am Familientisch gibt es viele Meinungen – und noch mehr Urteile. Im Gespräch mit der SPIEGEL-Bestseller-Autorin und Familienexpertin Nora Imlau werfen wir einen kritischen Blick auf kulturelle Prägungen, gesellschaftliche Erwartungen und elterliche Doppelmoral. Warum es beim Thema Medien weniger um starre Regeln und mehr um gelebte Beziehung gehen sollte – und wieso entspannte Familienmahlzeiten ganz unterschiedlich aussehen dürfen.
Überall liest man, dass man Medien am Familientisch vermeiden sollte. Das habe ich auch in meiner Ausbildung zur Ernährungscoachin gelernt. Und ich merke auch selbst, dass es mir besser geht, wenn ich bewusst und ohne Ablenkungen esse. Trotzdem finde ich, dass es definitiv Ausnahmen gibt. Wie siehst du das?
Es gibt bei diesem Thema auf jeden Fall Regeln, für die es gute Begründungen gibt, aber die sind auch oft mit gewissen Glaubenssätzen vermengt und auch mit kulturellen Vorstellungen davon, wie etwas richtig ist. Dadurch werden wir schnell intolerant gegenüber Familien, die andere Wege gehen.
Spannend. Inwiefern?
Es gibt ganz, ganz viele Kulturen, in denen es sehr üblich ist, dass den ganzen Tag der Fernseher läuft und oft auch nicht nur einer. Im Iran ist es zum Beispiel einfach in den vergangenen 50, 60 Jahren entstandene Tradition und Kultur. Besonders in der Kultur, die sonst sehr restriktiv ist. In der viele Menschen, zum Beispiel Frauen, sehr wenig miteinander Kontakt haben dürfen und sprechen dürfen. In einer solchen Kultur kann ein Fernseher in jedem Zimmer etwas sein, dass Menschen ein Gefühl gibt, nicht einsam zu sein. Italien ist ein völlig anderer Kulturkreis, indem es gewachsene kulturelle Tradition ist, das irgendwie alles übereinander passiert. In italienischen Bars ist es häufig so, dass der Fernseher an der Wand läuft, parallel ein Radio und die Leute unterhalten sich miteinander. Aus einer deutschen Perspektive würde man vielleicht sagen, das ist die totale Überstimulation. Und gleichzeitig wissen wir, dass in Italien zum Beispiel Esskultur einen hohen Stellenwert hat. Die Menschen essen dort sehr bewusst und sehr gerne, aber mögen es auch, wenn etwas dabei drumherum passiert. Das heißt, es gibt sehr unterschiedliche kulturelle Prägungen, was Essen, Medienkonsum und Reizumgebungen angeht.
Und wie ist es in Deutschland?
In Deutschland gibt es die Vorstellung, dass eine gute Mahlzeit eine stille Mahlzeit ist. Das ist noch eine Idee aus dem deutschen Biedermeier: Die Familie sitzt um den Tisch, alle beten einmal vorher und dann wird still gegessen. Das ist ein sehr, sehr deutsches Phänomen und das wurde in der Geschichte immer mal wieder aktualisiert, modernisiert und auch verändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist diese neue deutsche Bürgerlichkeit erstarkt und es gab ein neues Rollenmodel. Die Frauen kümmern sich um Haus und Heim und die Männer gehen arbeiten und alle haben viele Kinder. Da war der Familientisch auch ein Ort des Zusammenkommen und des Unterhaltens. Das hat natürlich positive Aspekte, denn entwicklungspsychologisch gesehen sind Gespräche am Esstisch toll. Aber gleichzeitig ist es eben auch ein enges Narrativ von doing family – also von der Vorstellung, wie man richtig Familie leben muss. Und das dient dann auch immer der sozialen Abgrenzung. Eine Familie, die keinen Esstisch hat, sondern zum Beispiel am Wohnzimmertisch vor dem Fernseher isst, wird in unseren Breiten oft auch mit einer gewissen sozialen Schicht assoziiert – nach dem Motto „Ungebildete Menschen essen vorm Fernseher, und zwar Fastfood“. Deswegen war gerade in der Nachkriegszeit ein Esszimmer zu haben auch einfach ein Statussymbol. Das muss man sich erst mal leisten können.
Wir müssen aus dieser komischen Selbstgerechtigkeit rauskommen.
— Nora Imlau
Ja, absolut. Es geht bei dem Thema ja auch immer um zeitliche und finanzielle Ressourcen. Und welche Rolle spielen diese Prägungen und kulturellen Komponenten heute noch?
Ich glaube, diese ganzen kulturellen Traditionen spielen in Deutschland beim Thema Essen bis heute eine große Rolle. Also die Frage, was „richtiges Essen“ ist? Das wird hier nicht nur nach entwicklungspsychologischen oder ernährungsphysiologischen Kriterien bewertet, sondern auch nach einem kulturellen Empfinden. Wie machen Menschen das richtig und was ist distinguiert? Was gehört sich? Was ist eine anständige Mahlzeit? Das kann dann schnell zu rassistischen Ausgrenzungen führen. Das passiert beispielsweise in sehr vielen Betreuungseinrichtungen. Da wird auf Elternabenden im Kindergarten gesagt, alle Familien sollen bitte abends gemeinsam um den Tisch sitzen und sich unterhalten. Da kommen Eltern aus einem anderen Kulturkreis und sagen: „Das haben wir noch nie gemacht. In unserer Kultur essen wir schon immer mit vier Generationen abends vorm Fernseher und wir sitzen auf dem Boden.“ Aus deutscher Perspektive wirkt das dann komisch. Es kann aber sein, dass das für diese Familien ein unglaublich wichtiges Gemeinschaftsgefühl ist. Wer sind wir, das zu bewerten? Wer sagt, dass nur die deutsche Weise richtig ist? Das führt zu engstirnigen Bewertungen und Schwarz-Weiß-Denken. Wir müssen aus dieser komischen Selbstgerechtigkeit rauskommen.
In Deutschland wird es grundsätzlich kritisch betrachtet, wenn der Fernseher viel läuft. Aber es gibt Menschen, die so aufwachsen und sich auch daran gewöhnen. Da ist der Fernseher dann mehr Hintergrundrauschen als Ablenkung. Die Kinder unterhalten sich trotzdem, die Kinder essen trotzdem und haben auch Freude am Essen. Es ist einfach eine andere Art aufzuwachsen und zu essen, als wir das in unseren Breiten kennen. Wir brauchen mehr Toleranz dafür, dass es viele Wege gibt, wie Mahlzeiten und Familie und Gesellschaft sich zueinander verhalten können.
Ja, das stimmt. Und es verändert sich ja oft auch zusätzlich über die Generationen.
Ja. Es gibt Menschen, die mir von den Mahlzeiten in ihrer eigenen Kindheit erzählen, die sie oft als sehr angespannt und gestresst erlebt haben. Es gab und gibt Kinder, die sich richtig fürchten vor diesen Abendessen. Und das ist in anderen Ländern anders. Ich weiß, dass in Amerika und in England diese TV-Dinners sehr üblich sind. Gerne Freitagabends, wenn die Woche vorbei ist. Alle setzen sich gemeinsam vor den Fernseher und essen etwas Fertiges. Das kann für viele Familien auch eine Entlastung darstellen. Sich nicht unterhalten und an den Esstisch setzen zu müssen, sondern zu sagen „Wir müssen gar nichts mehr, wir legen einen Film ein, wir kuscheln uns zusammen aufs Sofa und essen irgendwas Gemütliches.“
Wir machen das auch. Bei uns heißt es Couch-Abend und ja, wir lieben das alle sehr und empfinden es als sehr entspannend und als schönen Abschluss der Woche.
Du hast schon gesagt, dass Deutschland sehr medienkritisch ist im Vergleich zu anderen Ländern. Darüber schreibst du ja auch sehr ausführlich in deinem Buch „Bindung ohne Burnout“. Für mich war das total spannend und auch entlastend zu lesen. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Also generell zum Thema Medienkonsum, nicht nur in Bezug auf Mahlzeiten.
In Deutschland gibt es traditionell eine besonders große Kritik gegenüber neuen Medien, schon bei der Erfindung des Massen-Buchdrucks. Es wurde tatsächlich davor gewarnt, dass junge Frauen, die Liebesromane lesen, hysterisch werden könnten. Und das ist ein sehr deutsches Phänomen. Es gab hier schon immer eine sehr bewahrende, sehr traditionelle und eher konservative Haltung. Neue Sachen sind erstmal grundsätzlich gefährlich und das hat verschiedene historische Gründe. Die große Abneigung gegenüber neuen Medien und gegenüber Bildmedien ist zudem stark mit der Geschichte der Anthroposophie verknüpft.
Rudolf Steiner war aus Österreich, hat aber mit seiner Geisteslehre im deutschsprachigen Raum extrem stark gewirkt. Er hat die erste Waldorfschule in Stuttgart gegründet und in den 20er Jahren war das eine richtig große Bewegung, die auch sehr viele intellektuelle Menschen erreicht hat. Es gab von Anfang an viele Ärzte und viele Juristen, die Anthroposophen waren. Diese religiös-spirituelle Geisteshaltung hat gleichzeitig sehr stark in die echte Welt hinein gewirkt. Also die Frage: „Wie wollen wir unser Leben leben?“ Steiner hatte dazu Visionen und hat daraus dann seine Thesen abgeleitet.
Eine davon war, dass Menschen die Welt unmittelbar erfahren sollen und nicht mittelbar. Deswegen war er zum Beispiel auch kritisch gegenüber dem Lesen und gegenüber Bilderbüchern. Kinder sollen eine Blume anfassen und nicht in einem Buch anschauen. Es ist dadurch bis heute so, dass Waldorfschulen das Lesen lernen eher nach hinten schieben, im Vergleich zu staatlichen Schulen. Natürlich ist es wertvoll, die Welt mit allen Sinnen zu erleben, aber gleichzeitig wird daraus eben schnell eine Ideologie, wenn man sagt, dass Medien per se schädlich für die Entwicklung sind. Das ist ein sehr enger Horizont.
Und diese Theorie ist in der Anthroposophie lebendig geblieben und hat sich weiterentwickelt. Als Ende des Zweiten Weltkrieges das Fernsehen als Massenmedium aufkam, wurde gesagt, dass das noch schlimmer als Bücher sei – die völlige Entfremdung von der Welt. Das ist bis heute an Waldorfschulen absolut präsent und den Eltern wird sehr stark abgeraten, überhaupt mit Kindern fernzusehen. Auch Handys und Internet werden sehr kritisch und restriktiv betrachtet.
Unglaublich. Aber auch abseits von Waldorf gibt es ja diese Empfehlungen.
Es gibt tatsächlich viele Kinderärzte, die anthroposophisch sind und die das so sehen. Man muss sich dabei einfach klar machen, dass das nicht in Wissenschaftlichkeit begründet ist, sondern in einer spirituellen Grundüberzeugung. Ähnlich wie ein religiöses Gesetz. Auch wenn die Anthroposophie sich schon immer ein bisschen getarnt hat als eine Form von Wissenschaft. Und weil viele Ärzte Anthroposophen sind, ist das in den kulturellen und medizinischen Mainstream eingeflossen. In Bezug auf Bildschirmzeiten und Bildschirmempfehlungen spiegelt sich das in Deutschland super stark wider.
Das ist ja auch bei der Inititiave „Bildschirmfrei bis 3“ so. Darüber schreibst du auch im Buch.
Ja, diese Empfehlung ist noch relativ neu und wurde von einem Arbeitskreis vonverschiedenen Kinderärzt*innen erarbeitet. Maßgeblich wurde es von Ärzten der anthroposophischen Uni Witten Herdecke gepusht. Und dabei handelt es sich wirklich um eine „Steiner Uni“. Sie haben also aus Überzeugung heraus gewollt, dass diese Medien komplett verbannt werden.
Es gab nämlich auch andere Arbeitskreise, auch von Mediziner*innen, die ganz stark dagegengehalten haben. Gerade Ärzt*innen, die gesagt haben, dass diese pauschale Verurteilung von Bildschirmmedien besonders sozial schwächer gestellte Familien trifft. Die haben oft nicht den Luxus von viel Kinderbetreuung oder von großen Netzwerken. Die haben oft eine immense sozioökonomische Drucklage in ihrer Familie. Die brauchen Entlastungsmomente, die schnell und kostenlos verfügbar sind. Das wurde in diesem Gremium aber leider weggewischt.
Und was sagt die Wissenschaft zu diesem Thema?
Die Studienlage zum Thema Kinder und Bildschirmmedien ist hochkomplex und es gibt keine Wissenschaftler*innen auf der ganzen Welt, die sagen würden „Bildschirme und Kinder sind total unproblematisch. Egal was man macht, da kann nichts passieren.“ Aber nirgendwo sonst werden aus der aktuellen Forschung so restriktive Schlüsse gezogen wie in Deutschland. Und wenn man sich die Studienlage genauer anguckt, kann man auch zu dem Schluss kommen, dass Medien ganz große Potenziale bergen, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Medien können die Weltsicht bereichern und Sprachentwicklung fördern. Sie können Verbindungen zwischen Familienmitgliedern stärken, wenn gemeinsam Sendungen geschaut werden und man darüber ins Gespräch oder ins Spiel kommt. Es gibt ganz viele positive Potenziale von Kindermedien, über die in Deutschland fast gar nicht gesprochen wird. Es gibt gleichzeitig Risiken, die mit Medienkonsum einhergehen können und da gibt es vor allem zwei große Faktoren. Der eine ist, wenn Kinder Programme schauen, die nicht für ihr Alter geeignet sind. Das kann problematisch und entwicklungspsychologisch schädlich für Kinder sein. Und der zweite Risikofaktor ist, wenn der Medienkonsum überhand nimmt und dadurch den Raum einnimmt, der dann den Kindern an anderer Stelle für Entwicklungserfahrungen fehlt.
Schaut stärker auf die Inhalte, als auf die reine Zeit. Schaut auf das große Ganze.
— Nora Imlau
Hast du dafür ein Beispiel?
Wenn ein fünfjähriges Kind jeden Tag fünf, sechs Stunden fernsieht oder vor einem Tablet sitzt und sich in der Zeit sich bewegt, nicht mit Menschen spricht, nicht malt, dann fehlen ihm auf die Dauer seiner Entwicklungszeit gerechnet einfach irgendwann viele, viele Stunden an wichtigen Sinneswahrnehmungen. Das bedeutet nicht, dass jede halbe Stunde Fernsehen verlorene Lebenszeit ist. Es geht dabei um die Summe aller Dinge. Deswegen sagen viele Entwicklungspsycholog*innen, dass man sich weniger auf die Medienzeit an sich konzentrieren sollte, sondern auf all das, was drumherum passiert. Wenn ein Kind ein reiches, erfülltes Leben hat, mit Zeit in der Natur und mit Bewegung und mit Interaktion und mit Spaß, dann ist es ziemlich egal, ob es abends eine halbe Stunde fernsieht oder zwei Stunden. Das Kind hat sozusagen die wichtigen Eindrücke bekommen, die es für den Entwicklungsimpuls dieses Tages braucht. Aber wenn ein Kind ohnehin in einer eher anregungsarmen Umgebung aufwächst und es wird wenig mit ihm gesprochen und interagiert, dann können die Neuronen in seinem Gehirn quasi mangels Input verarmen. Der Fernseher darf nicht das einzige Sinnesangebot eines Tages sein. Diese Perspektive finde ich unglaublich wichtig und unglaublich entlastend: Schaut stärker auf die Inhalte, als auf die reine Zeit. Schaut auf das große Ganze. Medien stellen nicht nur eine Gefahr dar, sie haben auch großes Potential und Medienerfahrungen sind im Kontext aller anderen Erfahrungen eine Sinneswahrnehmung von vielen.
Das ist etwas, was in der deutschen Diskussion leider sehr stark fehlt. Und gerade diese sehr restriktiven Medienempfehlungen, die wir in Deutschland haben, die weltweit einmalig sind, sorgen bei Eltern vor allem für sehr viel Scham und Druck. Es gibt nämlich nur eine kleine Gruppe von Eltern, die sich an diese Empfehlungen halten können. Das sind oft sehr privilegierte Familien, und die erleben das dann auch oft als eine Form von Selbstbestätigung. Aber eine ganz, ganz große Gruppe von Eltern fühlen sich tendenziell beschämt und verstecken ihren Medienkonsum und sprechen auch nicht ehrlich darüber. Weder untereinander, noch mit Fachkräften, weil sie mit dem latenten Schuldgefühl herumlaufen, etwas falsch zu machen. Das ist ungünstig und führt zu dauerhaften Selbstabwertung bei Eltern. Deswegen sehe ich diese rigiden Empfehlungen, die an der Lebenswirklichkeit so vieler Eltern vorbeigehen, sehr kritisch.
Ja, total. Und ich fand das auch total entlastend, das noch mal so zu lesen und dadurch besser einordnen zu können. Ich finde, bei dem Thema kommt noch eine andere Ebene dazu. Ich kenne keinen Erwachsenen, der es nicht mal genießt, sich mit leckerem Essen vor den Fernseher oder Laptop zu setzen. Warum tun sich bei Kindern aber so viele schwer damit?
Wir sind oft im Umgang mit unseren Kindern von einer ganz großen Doppelmoral geprägt und das hat letztlich auch viel mit Adultismus zu tun, also mit der Idee, Erwachsene dürfen Dinge, die Kinder nicht dürfen, nur weil sie Kinder sind. Es gibt dann wirklich kein Argument, außer, dass sie jünger und von uns abhängig sind. Also es gibt einen guten Grund, warum wir ihnen kein Glas Rotwein gönnen, da würde ich nicht dafür plädieren. Aber es gibt ganz, ganz viele Alltagsfreuden, die wir uns gönnen und unseren Kindern nicht. Ein Beispiel: Viele Erwachsene nehmen sich abends vor, eine Folge ihrer Lieblingsserie zu gucken und nachher werden es drei. Da würde nie jemand sagen: „Oh, das ist jetzt aber mega inkonsequent.“ Bei Kindern sind wir aber oft super streng, wenn sie den gleichen Impuls haben. Es ist gerade super spannend und sie wollen noch eine Folge gucken. Dann werden wir fast wütend und sehen überhaupt nicht, dass wir selbst exakt dasselbe Verhalten an den Tag legen. Und wir haben auch oft nicht die Impulskontrolle, den Fernseher auszumachen, und wir sind viel älter.
Beim Essen ist das ganz genauso mit der Doppelmoral. Es gibt so viele Eltern, die sehr restriktiv sind mit Süßigkeiten und in dem Moment, wo die Kinder schlafen, kommen die großen Schokoladenpackungen raus.
Ja, dazu gibt es sogar viele „witzige“ Reels.
Ich finde das problematisch. Ich finde es deutlich authentischer zu sagen „Ich esse gerne Schokolade, du isst gerne Schokolade, wir essen das offen und sichtbar.“ Klar, es darf Regeln geben, was die Zeit und die Menge betrifft. Aber es ist besser, als abends dieses heimliche Binge Eating zu machen und tagsüber den Gesundheitsapostel zu geben. Das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass Eltern gute Eltern sein wollen und bestimmte Regeln umsetzen wollen. Und gleichzeitig haben sie das Gefühl, das bei sich selbst nicht zu können. Wenn ich meine eigenen Regeln eigentlich ziemlich scheiße finde, sind die dann vielleicht auch ein bisschen sehr restriktiv für meine Kinder? Das finde ich sehr schade, weil es letztlich etwas Trennendes ist. Es separiert die Welten der Kinder und Erwachsenen und befeuert innerhalb der Familie eine gewisse Heimlichtuerei.
Die Eltern essen abends heimlich Schokolade vorm Fernseher und die großen Kinder kaufen sich heimlich Süßigkeiten auf dem Heimweg von der Schule und essen sie schnell auf, weil sie zuhause nicht dürfen und Ärger bekommen. Und dann wundern sich Eltern, warum das Kind von seinem Taschengeld nur ungesunde Sachen kauft. Ich bin eine große Freundin davon, diese Genussmomente gemeinsam und ohne Scham und Schuld zu erlauben. Kindern wie Erwachsenen, völlig egal, was irgendwelche Empfehlungen sagen. Gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass wir “entspannen und wohlfühlen”, nicht automatisch und ausschließlich mit Medien und Süßigkeiten zu verknüpfen. Das passiert in vielen Familien nämlich leider auch schnell. „Heute war ein anstrengender Tag, da habe ich mir dieses große Eis und fünf Folgen Friends verdient.“ Wenn wir unseren Kindern diese Form von Selbstbelohnung vorleben, kann das ein schwieriges Muster sein.
Es sollte also unterschiedliche Formen von Entspannung und Belohnung geben.
Ja, denn in unserer Kultur sind Süßes und Medien sehr stark mit Belohnung verbunden. Ich habe vor einigen Monaten auf Instagram ein Abendessen von uns gezeigt. Ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwas mit viel Gemüse. Darunter stand der Satz: „Dieses leckere Essen haben wir uns heute wirklich verdient.“ Daraufhin haben mir ganz viele Menschen geschrieben, wie krass das für sie gewesen sei, diesen Satz im Zusammenhang mit Gemüse zu hören. Weil man bei Belohnung automatisch eher eine Schokotorte erwartet. Das war gar keine Absicht von mir. Wir sind an dem Tag kaum zum Essen gekommen und ich war froh, dass es eine große und sättigende und leckere Mahlzeit gibt.
Ich finde das sehr wertvoll in unserer Familie, dass dieses „Wir haben uns was verdient“ auch bedeuten kann, dass wir uns einen großen Abendspaziergang und einen Obstsalat verdient haben. Und an anderen Tagen essen wir Tiefkühlpizza vorm Fernseher und zwar egal, ob wir uns die verdient haben oder nicht. Einfach weil es gerade gut in den Tag passt.
Die Kinder handeln nicht gegen uns, sondern für sich.
— Nora Imlau
Das ist ein schönes Beispiel und passt auch gut zu meiner letzten Frage. Jede Familie ist anders. Es spielt ja eine Rolle, wie viele Kinder es gibt, wie der Alltag aussieht und welche Herausforderungen es noch gibt. Da ist es ja eigentlich nur logisch, dass (restriktive) Regeln nicht für jede Familie und jeden Alltag passen. Hast du aber vielleicht trotzdem ein paar Gedanken und Ideen für einen entspannten Umgang mit Medien und eine gute Atmosphäre beim Essen?
Das erste, was ich wirklich finde, ist, Medien wieder neutral zu betrachten. Für viele Menschen sind Medien ein totaler Triggerpunkt. Wenn mein Kind beim Essen mehrmals aufspringt, bin ich vielleicht ein bisschen genervt, aber wenn das Kind beim Essen etwas auf seinem Handy macht, triggert mich das viel stärker. Warum ist das so? Weil ich kulturell gelernt habe, dass das unhöflich ist. Zusätzlich denken viele Eltern dann sofort, sie hätten bei der Erziehung versagt. Da sollte man also neutraler drauf gucken. Ich kann den Trigger wahrnehmen, aber muss nicht sofort agieren oder wütend werden. Ich kann auch sachlich feststellen: „Du hast eine Message bekommen. Das scheint dir wichtig zu sein. Mir wäre es wichtig, dass du das Handy jetzt bitte weg legst, während wir essen. Ich versuche es selber auch.“ Diese ehrlich Kommunikation über Bedürfnisse ist so wichtig. Keine Verbote oder Drohungen.
Wir haben bei uns in der Familie die Regel, dass wir beim Essen nicht ans Handy gehen und diejenige, die es am schlechtesten schafft, bin ich. Meine Kinder dürfen mich dann natürlich auch darauf hinweisen.
Das zweite wäre, solche Regeln immer wieder kritisch zu hinterfragen. Warum haben wir die Regel? Vielleicht haben wir die Regel irgendwann mal aus einem guten Grund eingeführt, aber mittlerweile sind unsere Kinder fünf Jahre älter. Oder können wir bestimmte Regeln auf einzelne Mahlzeiten beschränken?
Auch die Frage nach dem Warum sollten wir uns immer wieder stellen. Also warum ist mir das jetzt so wichtig? Warum will ich jetzt ein Familienessen mit viel Kommunikation verbringen? Will ich das wirklich oder bin ich selber total fertig, habe aber das Gefühl, ich muss das jetzt machen? Da darf man auch entscheiden, dass es für alle jetzt besser und stressfreier wäre, einfach mal vor dem Fernseher oder getrennt zu essen. In diesem Zusammenhang finde ich den Satz „Die Kinder handeln nicht gegen uns, sondern für sich“ total wertvoll. Sie erfüllen sich mit Medien auch Bedürfnisse – nach Regulation, nach Zerstreuung, nach Verbindung und Kommunikation.
Oh ja. Das kenne ich auch. Kinder haben auch oft lange, volle Tage und sind dann einfach erschöpft, wenn sie nach Hause kommen. Und dann spielt es auch eine Rolle, wie reizsensibel ein Kind vielleicht ist.
Und an langen, vollen Tagen haben Kinder auch schon sehr viel kooperiert. Mein Empfinden ist, dass manchmal gerade auf dem Abendessen so eine große Erwartungshaltung lastet. Dabei sind dann alle schon müde und erschöpft. Bei uns gelingen diese verbindungsreichen Mahlzeiten meistens besser, wenn wir zum Beispiel am Wochenende zusammen brunchen. Also hier nochmal die Frage: Muss das unbedingt das Abendessen sein, an dem alle um den großen Tisch sitzen?
Und das Thema Reizsensibilität spielt natürlich auch eine Rolle, und auch Neurodivergenz. Das ist noch mal eine ganz eigene Geschichte. Viele neurodivergente Kinder überreizen leicht, es gibt aber auch neurodivergente Kinder, die sich extrem gut über Medien regulieren können. Es gibt Kinder, für die dieses bewusste Essen eine Qual ist, vor allem für manche autistischen Kinder, die sowieso sehr scharfe Sinneswahrnehmungen haben. Die brauchen manchmal regelrecht eine zweite Sinneswahrnehmung, damit das ausbalanciert wird. Es gibt auch Kinder, die sich sehr schwer damit tun, sich überhaupt auf bestimmte Lebensmittelgruppen einlassen zu können. Da kann es dann eine gute Strategie sein, ihnen beim Fernsehen einen Teller mit Gemüse hinzustellen. Es ist oft leichter, neues Gemüse nebenher zu snacken als im vollen Fokus des Familienessens.
Also sollte letztendlich jede Familie schauen, was für sie und die eigenen Lebensumstände gut passt. Dabei muss man sich ein Stück weit frei machen, von den Regeln und Erwartungshaltungen, die einem von außen signalisiert werden.